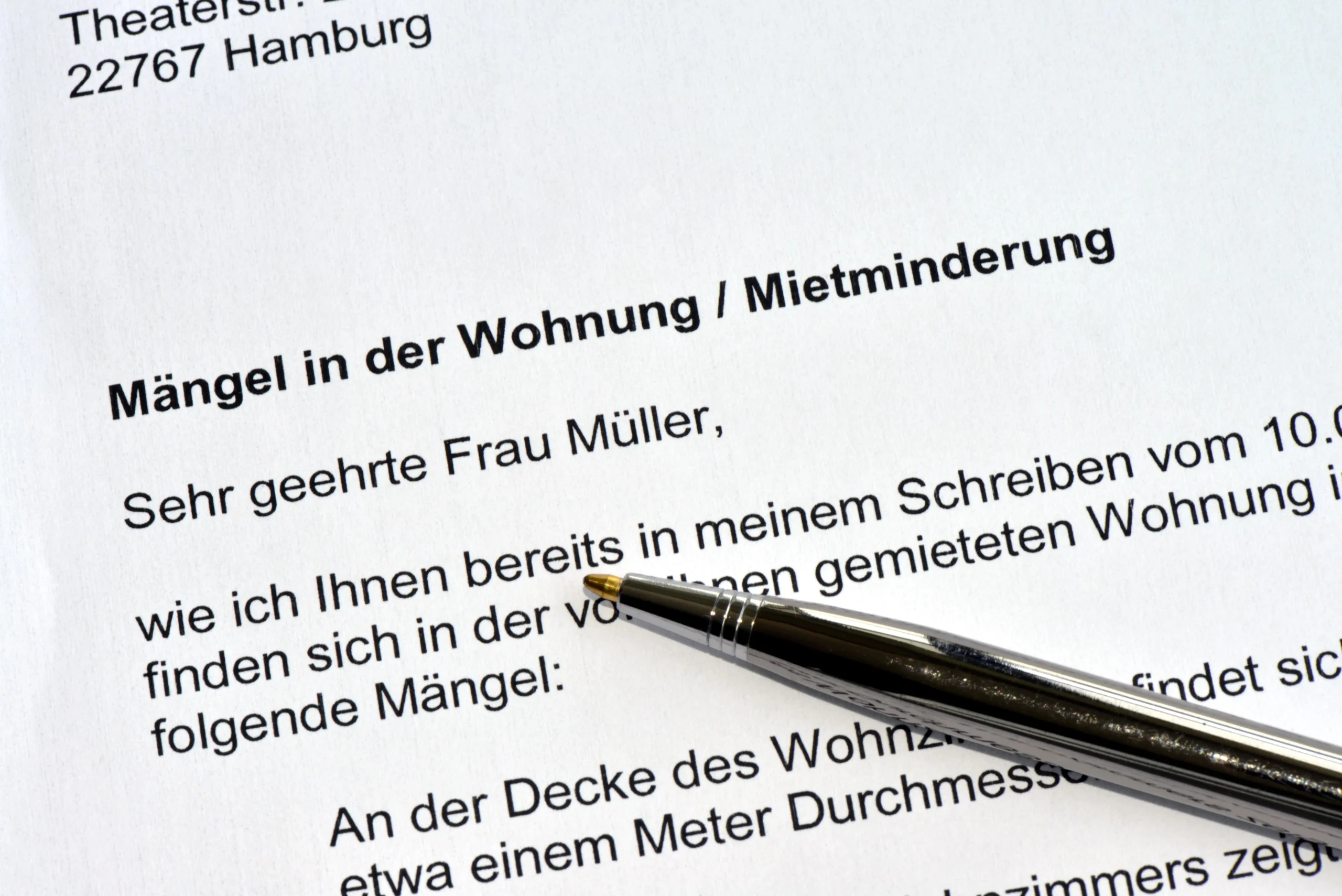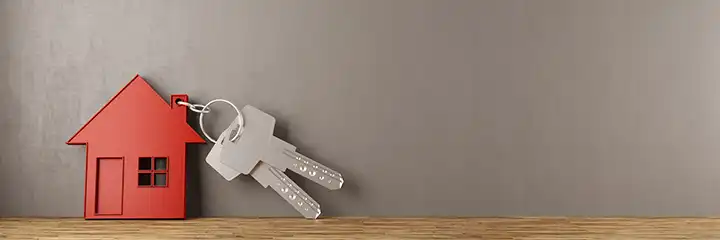Wer haftet?
Handelt es sich um Abnutzung durch Gebrauch, oder Beschädigungen am Mietobjekt?
Immer wieder erreichen uns Fragestellungen dieser Art im Zusammenhang mit der Beendigung eines Mietverhältnisses. Vermieter bemängeln Schäden bei der Wohnungsübergabe, halten die Mietkaution lange zurück und melden sich eines Tages mit Schadensersatzforderungen bei den ehemaligen Mietern. Nicht selten entfacht ein Streit zwischen den Parteien über angeblich ersatzpflichtige Schäden oder möglicherweise doch nur Gebrauchsspuren durch Nutzung.
Die Mieter sind gemäß § 546 Abs.1 BGB dazu verpflichtet, die Mietwohnung nach Beendigung des Mietverhältnisses an die Vermieter zurückzugeben. Diese Selbstverständlichkeit birgt in der alltäglichen Praxis jedoch sowohl für Mieter als auch für Vermieter die meisten Probleme. Ist die Wohnung nur durch vertragsgemäßen Gebrauch, welchen die Vermieter hinnehmen müssen, abgenutzt oder haben die Mieter Schäden in der Wohnung verursacht?
Wir wollen hier auf häufige Fragen und Probleme eingehen, die uns in unserem Alltag als Anwälte für Mietrecht erreichen.
Die rechtliche Grundlage
Gemäß § 538 BGB hat der Mieter Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache, die durch den vertragsgemäßen Gebrauch herbeigeführt werden, nicht zu vertreten.
Mieter sind demnach vertragsgemäß in der Pflicht, das Mietobjekt pfleglich zu behandeln und achtsam mit der Mietsache umzugehen. Fahrlässig verursachte Schäden oder sogar Zerstörungen sind in vollem Umfang durch Mieter zu ersetzen. Grundsätzlich müssen Mieter die Mietsache in dem Zustand zurückgeben, in welchem sie die Wohnung bei Mietbeginn auch empfangen haben.
Die Regelung des § 538 BGB enthält einen Mechanismus, welcher die Mieter entlastet und im Grundsatz davon ausgeht, dass die Mieter die Veränderungen oder Verschlechterungen, die durch den vertragsgemäßen Gebrauch herbeigeführt werden auch nicht zu vertreten haben. Zu vertreten bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Mieter erstmal nicht für diese verantwortlich sind und beispielsweise auch nicht schadensersatzpflichtig sind.
Diese Regelung soll sowohl die Vermieter als auch die Mieter schützen. Es wird damit gewährleistet, dass keine der beiden Parteien unsachgemäß benachteiligt wird. Der Mieter muss die Wohnung nicht „besser“ zurückgeben als er sie damals erhalten hat, und der Vermieter erhält sie nicht wesentlich „schlechter“ zurück als bei Abschluss des Mietvertrages.
Damit wird deutlich, dass das Mietrecht zwischen von Mietern verursachten Beschädigungen und Veränderungen oder Verschlechterungen durch vertragsgemäßen Gebrauch unterscheidet. Aber was genau bedeutet das für Mieter und Vermieter, und worin liegt eigentlich der Unterschied?
Was ist „vertragsgemäßer Gebrauch“?
Der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache zeichnet sich dadurch aus, dass die Mietsache leichte und altersbedingte Spuren durch regelmäßige Nutzung aufweist. Diese sind zum Beispiel:
- Verfärbungen und Abnutzungsschäden an Wänden, Türen, Fenstern, Decken, Heizkörpern
- Kratzer oder kleine Stoßmacken an Oberflächen wie Türen, Wänden, Schränken, Böden
- Druckstellen oder Laufspuren im Teppich
- Geringfügige Dellen und Lackabsplitterungen an Einbauküchen
- Kalkablagerungen im Sanitärbereich
- Anbringung von Haltevorrichtungen wie Dübel, Haken und Schrauben (AG Chemnitz – 16 C 1527/22)
- Sichtbare Aufstellspuren von Blumenkübeln auf der Terrasse
- Bei genehmigter Tierhaltung auch Kratzer an den Türen oder im Parkett (LG Koblenz, Urteil vom 6.5.2014 – 6 S 45/14)
Diese Abnutzungen muss der Vermieter akzeptieren und darf sie nicht dem Mieter zur Last legen. Der vertragsgemäße Gebrauch ist Bestandteil des Mietvertrages, die Wiederherstellung der Mietsache, nachdem sie vertragsgemäß gebraucht wurde, wird schon mit Zahlung der Miete abgegolten und fällt in der Regel in den Verantwortungsbereich des Vermieters nach Beendigung des Mietverhältnisses.
Vorsicht geboten ist bei individuellen Absprachen zwischen den Parteien, in welchen die Pflicht des Vermieters, die Mietsache während der Mietzeit in einem vertragsgemäßen Gebrauch zu halten (§ 535 Abs. 2 BGB) auf die Mieter abgegeben wurde.
Es ist jedoch zu beachten, dass das Merkmal des „vertragsgemäßen Gebrauchs“ vom Gesetzgeber nicht definiert wurde, sodass immer die individuellen Abreden zwischen den Parteien einen entscheidenden Faktor darstellen. Jedoch fallen nach der Gesetzesbegründung von § 538 BGB sämtliche „Verschleißschäden“ unter den Begriff des vertragsgemäßen Gebrauchs.
Viele Beispiele des vertragsgemäßen Gebrauchs sind jedoch lediglich auf die Nutzung während der Mietzeit anwendbar und sind bei Rückgabe der Wohnung wieder rückgängig zu machen.
So haben Vermieter es beispielsweise hinzunehmen, wenn Wände bunt gestrichen werden, jedoch stellt dieser durchaus vertragsgemäße Gebrauch einen Umstand dar, der am Ende der Mietzeit wieder geändert werden muss.
Was genau sind Schäden und was sind Mängel an der Mietsache?
Schäden gehen über leichte Gebrauchsspuren hinaus und erfordern Reparatur oder Ersatz. Schäden sind letztlich alle negativen Veränderungen, die der Mietsache anhaften, welche diese zu Beginn des Mietverhältnisses noch nicht aufwies. Ein Schaden an der Mietsache kann gleichzeitig auch einen Mangel dieser darstellen.
Maßgeblich ist, ob die Vermieter mit der Veränderung oder Verschlechterung rechnen mussten oder nicht.
Schäden an der Mietsache, mit welchen Vermieter nicht rechnen müssen können beispielsweise sein:
- Flecken im Teppich (Rotwein, Fett oder Urin)
- Kratzer im Bodenbelag oder auf Glasflächen
- Hartnäckige Klebereste von geklebtem Teppichboden
- Löcher in Wänden oder Türen
- Gebrochene oder abgerissene Scharniere oder Türen von Möbeln (Schränke, Küche)
- Schimmel durch mangelhaftes Lüftungsverhalten
- Wasserschäden an Wänden oder Böden (offene Fenster bei Regen, ausgelaufenes Blumengießwasser oder undichte Waschmaschine)
- Defekte Rollläden, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt wurden
Schäden, die nicht unter den vertragsgemäßen Gebrauch fallen, dürfen Vermieter ersetzt oder repariert verlangen. Doch auch hier gilt: Die Mieter müssen die Verschlechterung zu vertreten haben. Es gilt jedoch, dass jegliche Schäden der Mietsache, die die Mieter vorsätzlich und absichtlich herbeigeführt haben, zu einer Schadensersatzpflicht der Mieter führen.
Liegt die Verschlechterung oder Veränderung außerhalb des Verantwortungsbereiches der Mieter, so können Vermieter keine Ansprüche gegen ihre Mieter geltend machen.
Wer trägt die Beweislast und wofür?
Aus unserer Beratungspraxis und unzähligen Fällen dieser Natur erkennen wir wiederkehrende Muster: Vermieter verlangen einen Vollaustausch von Elementen, statt eine fachmännische Reparatur dieser zu akzeptieren. Oder Vermieter verlangen eine Kostendeckung einer überhöhten Reparatur-Rechnung, obwohl es kein günstigeres Vergleichsangebot gab.
Verständlich ist, dass Mieter diese Kosten in Frage stellen und sich weigern, diese widerstandslos zu begleichen.
Nicht selten behalten Vermieter die Kaution nicht nur ein, sondern verlangen zusätzlich weitere Kostendeckungen. Mieter zweifeln die Rechtmäßigkeit dieser Vorgehensweise an und vermuten sogar eine Aufwertung/ Renovierung der Wohnung auf ihre Kosten.
Andererseits erleben wir es ebenfalls, dass Mieter versuchen die Wohnungen in deutlich verschlechtertem Zustand zurückzugeben und sich weigern, die selbstverursachten Schäden zu beseitigen. Auch hier ist verständlich, dass Vermieter nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben wollen.
HINWEIS: Grundsätzlich ist wichtig und zu beachten, dass Vermieter die Beweislast dafür tragen, dass ein bestimmter Zustand der Mietsache bei der Rückgabe geschuldet wird.
Die Beweislast der Vermieter ist in zwei Teile aufzuteilen. Einerseits müssen Vermieter beweisen, dass die Schäden bei der Übergabe der Wohnung zu Mietbeginn noch nicht vorhanden waren. Andererseits tragen die Vermieter die Beweislast dafür, dass die Mieter die Schäden auch zu vertreten haben und dass diese in deren Verantwortungsbereich fallen.
Das wichtigste, einfachste und kostengünstigste Mittel, um diesen Beweis zu erbringen stellt das Übergabeprotokoll zu Beginn und am Ende des Mietverhältnisses dar. Im Rahmen des Übergabeprotokolls zu Beginn des Mietvertrags sollten alle Makel oder Besonderheiten der Wohnung aufgeführt werden, damit am Ende ein „Vorher-Nachher“ Vergleich stattfinden kann.
Jegliche Mängel, welche dann am Ende der Mietzeit dazugekommen sind, waren folglich zu Mietbeginn noch nicht vorhanden und sind folglich während der Mietzeit entstanden. Dann muss der Vermieter danach noch beweisen, dass die Schäden von den Mietern zu vertreten sind.
Hierfür müssen die Vermieter jegliche Schadensmöglichkeiten ausräumen, die in ihren Verantwortungsbereich fallen würden. Im Streitfall bedeutet dies, dass Vermieter ausführlich darlegen müssen, welche Maßnahmen sie getroffen haben, um den konkreten Schaden zu vermeiden. Erst wenn die Vermieter ausführlich und ausreichend ihrer Darlegungspflicht nachgekommen sind, werden die Mieter darlegungs- und beweispflichtig. Diese müssen dann wiederum beweisen, dass sie die Mietsache lediglich vertragsgemäß gebraucht haben und sie den Schadenseintritt nicht zu vertreten haben. Des Weiteren tragen die Mieter die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Vermieter mit den Abnutzungsspuren rechnen mussten und kein Schaden entstanden ist.
Welche Möglichkeiten zur Erbringung des Beweises bestehen noch?
Eine weitere Möglichkeit (sowohl für Vermieter als auch für Mieter) die eigenen Standpunkte zu beweisen ist es, einen Gutachter mit der Klärung der Fragen zu beauftragen. Hierbei ist jedoch wichtig, dass sich die Parteien nach Möglichkeit gemeinsam auf den Gutachter einigen, dies minimiert die Gefahr, dass eine der Parteien das Gutachten am Ende nicht anerkennt. Die Beauftragung eines Gutachters empfiehlt sich aus Kostengründen jedoch meistens nur bei hohen Sachschäden oder Beeinträchtigungen der Mietsache, durch die die Substanz an sich beschädigt wurde.
HINWEIS: Wird ein Gutachter beauftragt, so sollte bereits vor Beauftragung zwischen den Parteien eine Entscheidung darüber getroffen worden sein, wer die Kosten für diesen trägt.
Sollte es um kleinere Schäden oder Mängel gehen, so sind Kostenvoranschläge und Angebote von Handwerkern ein guter Weg, um einen Überblick über die Kostenfrage zu erhalten. Damit Mieter die entstandenen Kosten eher akzeptieren bietet es sich erfahrungsgemäß an, mehr als ein Angebot einzuholen, damit ein Vergleich zwischen diesen möglich ist und auch ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass diese Kosten „tatsächlich“ entstanden sind.
Reparatur oder Ersatz – können Kosten anteilig aufgeteilt werden?
Eine zentrale Frage, die sich für beide Parteien bei der Schadensabwicklung stellt, ist zumeist, ob beschädigte Sachen in der Wohnung ersetzt werden müssen oder ob der Vermieter auch eine Reparatur der Sache hinnehmen muss.
Eine pauschale Antwort auf diese Frage ist in den allermeisten Fällen jedoch nicht möglich, es kommt insgesamt immer auf die Gesamtumstände und den Einzelfall an. Hier ist nochmals auf den Grundsatz zu verweisen, dass keine der Parteien am Ende besser oder schlechter gestellt sein sollte, als sie es zu Beginn des Mietvertrages war.
Bei der Abwägung zwischen Neuanschaffung und Reparatur ist beispielswiese mit einzubeziehen, wie alt die beschädigte Sache an sich war, wie groß der Schaden an der Sache ist und mit welchem Aufwand eine Reparatur durchgeführt werden könnte.
Im nächsten Schritt ist dann zu entscheiden, ob die Instandsetzung durch einen Handwerksbetrieb durchgeführt werden muss oder ob die Selbstvornahme durch die Mieter ausreichend ist. Hier kommt es ebenfalls, wie so oft, auf die Einzelumstände und die individuellen Interessen der Parteien an. Während beschädigte Elektrik wohl immer fachmännisch repariert werden sollte, kann und muss nicht erwartet werden, dass die Malerarbeiten von einem Fachbetrieb ausgeführt werden.
Während grundsätzlich ganz eindeutig geregelt ist, dass Mieter für die von ihnen vertretenen Schäden einstehen müssen, so kann die Frage nach einer Kostenteilung trotzdem eine entscheidende Rolle spielen.
Wünscht sich der Vermieter die Instandsetzung durch einen Fachbetrieb, stellt sich der Schaden aber derart dar, dass der Mieter diesen auch im Wege der Selbstvornahme beheben kann, so könnte eine anteilige Kostenteilung das Mittel der Wahl für beide Seiten sein.
Die Mieter sollten bei der Wiederherstellung des Zustandes bei Mietbeginn nicht plötzlich für die Verbesserung der Mietsache an sich bezahlen müssen, trotzdem können Vermieter ein berechtigtes Interesse an der Beauftragung eines Fachbetriebs haben.
Hinweis: Grundsätzlich besteht für Vermieter keine Pflicht Kosten anteilig zu übernehmen, wenn die Schäden von den Mietern verursacht wurden und der Vermieter keine höheren Erwartungen hat, als er haben darf.
Wofür kann ein Mieter seine Haftpflichtversicherung heranziehen?
Schäden an der Mietsache, die ersatzpflichtig sind, und einem Verschulden des Mieters zuzuordnen sind, können möglicherweise durch dessen Haftpflichtversicherung beglichen werden. Klassische Beispiele hierfür sind Wasserschäden durch einen geplatzten Schlauch an der Waschmaschine, die nicht nur in der eigenen Wohnung, sondern auch in der darunter befindlichen Wohnung auftreten können und reguliert werden müssen.
Auch durch Kinder verursachte Schäden sind – je nach Versicherung- abgedeckt.
Hierbei ist wichtig, dass die Versicherung so schnell wie möglich über den Vorfall informiert wird und der Schaden nicht vorsätzlich hervorgerufen wurde.
Was sind verschuldete und somit voll ersatzpflichtige Schäden, die ein Mieter bezahlen muss?
Jegliche fahrlässig herbeigeführten Beschädigungen oder bewusste Zerstörungen sind dem Verhalten und der Verantwortung der Mieterpartei zuzuordnen. Tiere, die ihr Geschäft in der Wohnung verrichten gehen über den vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung nebst Tierhaltung hinaus. Ebenfalls gehen regelmäßig eskalierende und ausschweifende Veranstaltungen oder Partys weit über den vertragsgemäßen Gebrauch hinaus. Kommt es dabei zu abgerissenen Armaturen oder Türklinken, Löchern in Möbeln oder Wänden, Brandflecken oder Glasbrüchen in Zwischentüren oder Fenstern, so ist klar, dass die Mieter für diese aufkommen müssen.
Ähnlich gestaltet es sich bei Wut- oder Kraftausbrüchen. Ein Loch in der Wand, weil der Mieter seine Wut nicht unter Kontrolle hat, ist ein voll ersatzpflichtiger Schaden.
Grundsätzlich wird der Mieter zum Ersatz von Schäden verpflichtet, wenn die Substanz der Mieträume beschädigt wird und die Beschädigung auf fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten der Mieter zurückzuführen ist.
Was muss der Mieter eigenständig dem Vermieter mitteilen?
Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, welches Verhalten richtig wäre, damit man als Mieter kein Risiko eines späteren Rechtstreits eingeht.
Vorsicht ist immer besser als Nachsicht, jedoch sollten Vermieter auch nicht unnötig mit Mitteilungen belangt werden. Wenn offensichtlich kein Grund zum Einschreiten seitens des Vermieters besteht, dann kann auf eine Anzeige durch die Mieter verzichtet werden.
Viele Schäden an der Mietsache stellen gleichzeitig auch Mängel dieser dar, so ist zum Beispiel eine defekte Tür nicht nur ein Schaden, der ersetzt werden muss, sondern auch ein Mangel der Mietsache, den der Vermieter beseitigen muss.
Die Anzeige der Mängel, welche während der Mietzeit auftreten ist in § 536c BGB ausdrücklich gesetzlich geregelt. Es wird hier erstmal nicht unterschieden zwischen Mängeln, die die Mieter selbst verursacht haben und Mängeln, die außerhalb ihres Verantwortungsbereichs liegen.
Die Nichtanzeige kann auch für Mieter gravierende Folgen haben. Unterlassen sie die Anzeige der Mängel, so können Mieter wiederum zum Schadensersatz verpflichtet werden, wenn den Vermietern ein Schaden aufgrund der Nichtanzeige entsteht.
Um die Frage beantworten zu können, was Mieter eigenständig den Vermietern mitteilen müssen, ist der Einzelfall zu betrachten. So sind jedoch in jedem Fall Mängel und Schäden wie
- Wasserschäden
- Schimmel
- Defekte Heizungen
- Unzureichendes Warmwasser
- Beschädigte Haus oder Wohnungstüren
und jegliche Mängel oder Schäden, die die Mietsache in ihrer Substanz an sich beeinträchtigen können, anzuzeigen.
Wann müssen Schäden an Vermieter gemeldet werden?
Der richtige Zeitpunkt für eine Schadensmeldung ist entscheidend, ein Aussitzen des Problems bis zum letzten Tag des Mietverhältnisses ist nicht immer ratsam. Es soll sogar Mieter geben, die einen Schaden als Mietmangel deklarieren und versuchen, hiermit sogar eine Mietminderung durchzusetzen. Dies ist jedoch keinesfalls ratsam, da aufgrund von Wohnungsübergabeprotokollen heutzutage Schäden eindeutig einem bestimmten Mietverhältnis zugeordnet werden können. Versuchter Betrug kann und wird in den allermeisten Fällen hart bestraft werden.
Wir empfehlen ein proaktives Verhalten seitens der Mieter und ein ehrliches, offenes Herantreten an den Vermieter im Falle von Beschädigungen am Mietobjekt.
Aus der Regelung des § 536c Abs.1 BGB ergibt sich, dass die Mieter die Schäden, die während der Mietzeit auftreten, unverzüglich anzuzeigen haben. Unverzüglich bedeutet in der Rechtssprache „ohne schuldhaftes Zögern“ (§ 121 BGB). Dies lässt sich nicht auf konkrete Zeitwerte übersetzen, Mieter sollten jedoch auch hier situationsangepasst handeln.
Während bei einem Wasserschaden „ohne schuldhaftes Zögern“ sofort bedeutet, ist dies nicht bei jedem Mangel der Fall. Es kommt beim Zeitpunkt der Mängelanzeige auf die Erkennbarkeit für den durchschnittlichen nicht besonders geschulten Mieter an. Mieter tragen keine Pflicht zu Nachforschungen, ob Mängel in der Mietsache vorliegen, wenn es keinen Gefahrenverdacht gibt (OLG Düsseldorf, Hinweisbeschluss vom 2. 6. 2008 – 24 U 193/07).
Sobald Mieter jedoch Kenntnis eines Mangels haben, sollten sie den Mangel so schnell wie möglich an ihre Vermieter melden. Besonders bei gravierenden Schäden wie einem defekten Fenster oder einer beschädigten Wohnungstür, sollte der Vermieter unverzüglich kontaktiert werden, um weitere Folgeschäden an oder in der Wohnung zu vermeiden.
Auch hier gilt, dass das verspätete Anzeigen der Mängel zur Schadensersatzpflicht der Mieter führen kann, wenn den Vermietern ein Schaden aufgrund der verspäteten Anzeige entsteht.
Welche Schäden muss der Mieter nicht oder nicht unverzüglich anzeigen?
Nicht angezeigt werden müssen hingegen sämtliche Gebrauchsspuren, die dem vertragsgemäßen Gebrauch entsprechen. Gebrauchsspuren, welche dem vertragsgemäßen Gebrauch entsprechen, stellen demnach auch keine Schäden im Sinne der Anzeigepflicht nach § 536c BGB dar. Hierzu gehören beispielsweise Kratzer auf dem Bodenbelag durch das Verrücken von schweren Möbeln. Diese gefährden nicht die Sicherheit des Mietobjekts und können auch später kommuniziert und behandelt werden. Als Mieter müssen Sie Ihre Vermieter nicht über jede Änderung der Wandfarbe oder aufgehängte Regale informieren.
Haben die Parteien individuell miteinander vereinbart, dass der Mieter „Schönheitsreparaturen“ selbst übernimmt, so müssen Mieter entsprechende Schäden und Reparaturen den Vermietern nicht anzeigen.
Mieter sollten jedoch gegen Ende ihrer Mietzeit eine Bestandsaufnahme der vertragsgemäßen Gebrauchsspuren machen und ihre Vermieter über diese in Kenntnis setzen. Dies macht die Abwicklung am Ende leichter und ermöglicht es den Vermietern, die Mietsache entsprechend lückenlos weitervermieten zu können.
So sind beispielsweise alte Rollladengurte kein Mangel, der unverzüglich angezeigt werden muss, jedoch ist es für die Weitervermietung sinnvoll, von diesem Umstand zu wissen.
Darf man als Mieter eigenständig ohne Kenntnis durch den Vermieter Gegenstände in der Wohnung ersetzen bzw. austauschen?
Getreu dem Motto: „Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß“ liegt ein kommentarloser Austausch eines defekten Elements der Mietwohnung zunächst auf der Hand. Man umgeht lästige Kommunikation, muss dem Vermieter zwecks Sichtung des Schadens keinen Zutritt gewähren. Doch: Muss der Vermieter dies akzeptieren?
Grundsätzlich gilt, dass komplette Alleingänge wohl selten gern gesehen sind. Jedoch kommt es selbstverständlich auch hier immer auf die einzelne Situation an. Was für ein Verhältnis besteht bisher zum Vermieter, welche Gegenstände sollen getauscht werden und um welche Preisklassen handelt es sich?
Kleinere Reparaturen, vor allem solche die nötig werden, weil sie auf den alltäglichen Gebrauch der Wohnung zurückzuführen sind, können selbst vorgenommen werden.
Für größere Schäden und Mängel gilt die Regelung des § 536a Abs. 2 BGB. Mängel können erst dann selbst beseitigt werden und Ersatz dafür verlangt werden, wenn der Vermieter mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist oder die umgehende Beseitigung des Mangels zur Erhaltung oder Wiederherstellung des Bestands der Mietsache notwendig ist.
Damit der Vermieter mit Beseitigung des Mangels in Verzug sein kann, muss dieser jedoch davor von den Mietern über den Mangel in Kenntnis gesetzt worden sein.
Eine umgehende Beseitigung kann beispielsweise bei eintretendem Regenwasser gefragt sein, damit die Mietsache überhaupt derart erhalten werden kann und es nicht zu weiteren Schäden kommt.
Ein typisches Praxisbeispiel
Das Kind ist mit seinem Bobbycar in der Wohnung umhergefahren, die Mutter befand sich zwar in der Aufsichtspflicht, konnte aber in diesem Moment gerade nicht einschreiten. Das Bobbycar wurde gegen die Lackfront der Küche gefahren, es entstand eine Delle, der Lack ist abgeplatzt.
Hier können unterschiedliche Varianten entstehen:
- Niemand teilt den Schaden dem Vermieter mit, alles bleibt so, wie es ist bis zum Tag der Wohnungsübergabe bei Auszug („klären wir dann schon irgendwie“).
Vorteil: vermeintlich wenig Arbeit, der Schaden beeinträchtigt die Substanz nicht, in diesem Moment entstehen zunächst keine Kosten für die Mieter.
Nachteil: Ärger am Ende des Mietverhältnisses ist vorprogrammiert, die Mieter haben die Pflicht, Mängel unverzüglich anzuzeigen, abgeplatzter Lack könnte zu weiteren Schäden führen, was zu höheren Kosten führen könnte.
- Die Mieter teilen dem Vermieter den Schaden nicht mit, bessern den Schaden selbst aus, verfüllen die Delle, lackieren die Stelle über.
Vorteil: Der Mangel ist behoben, der Schaden könnte grundsätzlich vertragsgemäßer Gebrauch bei Vermietung an Familien mit Kindern sein.
Nachteil: Der Vermieter könnte mit Art und Weise der Schadensbehebung unzufrieden sein, Streitigkeiten beim Auszug könnten entstehen, die Anzeigepflicht von Mängeln wurde missachtet, die Mieter tragen die Kosten in jedem Fall selbst.
- Die Mieter ersetzen ohne Information an den Vermieter die ganze Schranktür durch eine neue.
Vorteil: Der Vermieter wird nicht behelligt, der Mangel wird behoben.
Nachteil: Anzeigepflicht von Mängeln missachtet, die Mieter tragen die Kosten in jedem Fall selbst.
- Die Mieter beauftragen einen Fachbetrieb, z.B. Möbeltischler und lassen die Stelle fachgerecht reparieren, teilen dies dem Vermieter nicht mit.
Vorteil: fachgerecht repariert, keine weiteren Schäden zu befürchten.
Nachteil: Anzeigepflicht von Mängeln missachtet, die Mieter tragen die Kosten in jedem Fall selbst.
- Der Vermieter wird zeitnah über den Schaden informiert, man bespricht eine Vorgehensweise, kontaktiert ggf. eine Versicherung.
Vorteil: Kostenübernahme durch eine Versicherung, die klare und offene Kommunikation mit dem Vermieter macht den Auszug in der Regel leichter.
Nachteil: Die Kostenübernahme durch die Versicherung ist nicht sicher.
Unser Tipp: Kontaktieren Sie bei jeglichen Mängeln oder Schäden Ihrer Wohnung Ihren Vermieter zeitnah und sprechen Sie offen über die verschiedenen Möglichkeiten, den Mangel zu beheben. So vermeiden Sie lange Streitigkeiten nach Ihrem Auszug und behalten ein entspanntes Verhältnis zu Ihren Vermietern.
Können Ansprüche auch verjähren?
Schadensersatzansprüche von Vermietern können verjähren. Nachdem die Mietsache an die Vermieter zurückgegeben wurde, haben Vermieter gemäß § 548 Abs.1 BGB sechs Monate Zeit ihre Schadensersatzansprüche wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache gegenüber ihren Mietern geltend zu machen. Bis zu diesem Zeitpunkt können Vermieter in der Regel auch die Kaution einbehalten, um eventuelle Schäden mit dieser zu begleichen.
Auch die Ansprüche der Mieter gegen die Vermieter auf Ersatz von Aufwendungen oder Gestattung der Wegnahme der Einrichtung können verjähren. Diese verjähren jedoch sechs Monate nach Beendigung des Mietverhältnisses. Die Beendigung des Mietverhältnisses ist der Zeitpunkt, an dem der Mietvertrag endet. Die Rückgabe der Wohnung kann auch später oder früher stattfinden, sodass die Termine der Verjährung für Mieter und Vermieter nicht unbedingt auf den gleichen Tag fallen müssen.
Sinn und Zweck der kurzen Verjährungsfrist ist es, eine schnelle Abwicklung des beendeten Mietverhältnisses zu gewährleisten und schnell Rechtssicherheit für beide Parteien zu schaffen. Es ist vor allem dann, wenn eine Mietsache bereits mehrmals weitervermietet wurde nicht mehr oder nur unzureichend feststellbar, wer welche Mängel zu verschulden hat.
Was raten wir von der Kanzlei Streich und Wittke unseren Mandanten?
Wir raten sowohl Mietern als auch Vermietern in einem Gespräch vor Mietbeginn die jeweiligen Erwartungshalten zu besprechen und sich über diese auszutauschen. Möchten Vermieter, dass kleinere Reparaturen selbstständig durchgeführt werden oder möchten sie über alles erst einmal informiert werden? Sind die Mieter in der Lage Reparaturen durchzuführen? Alle dies sind Fragen, die in einem offenen und respektvollen Umgang miteinander geklärt werden können.
Damit besteht die Möglichkeit einen individuell auf alle Bedürfnisse angepassten Mietvertrag zu erstellen oder vorgefertigte Verträge zumindest individuell zu ergänzen. Dies führt zu einer „wasserdichten“ Vorgehensweise und beugt auch späteren Streitigkeiten vor, da etwaige Streitpunkte bereits bei Vertragsbeginn miteinander und individuell geklärt wurden.
Weiterführende Informationen
Wir haben auch weitere wertvolle Infos aus dem Bereich des Mietrechts für Sie. Erfahren Sie im Allgemeinen und im Speziellen Details zu Mieterpflichten und Vermieterpflichten.
Schönheitsreparaturen im Mietvertrag
Die Wohnungsübergabe – So ist es richtig
Rückzahlung der Kaution – Wie lange muss der Mieter Geduld haben?
Wasserschaden Mietwohnung
Rückgabe der Mietsache – Das müssen Vermieter beachten
Bildnachweis: AdobeStock_484445649-1-1
Zu guter Letzt
Wir möchten uns an dieser Stelle bei unserer Co-Autorin Anna-Sophie Zdunek für das konstruktive Mitwirken an diesem informativen Beitrag bedanken. Sie unterstützt uns als rechtswissenschaftliche Mitarbeiterin.