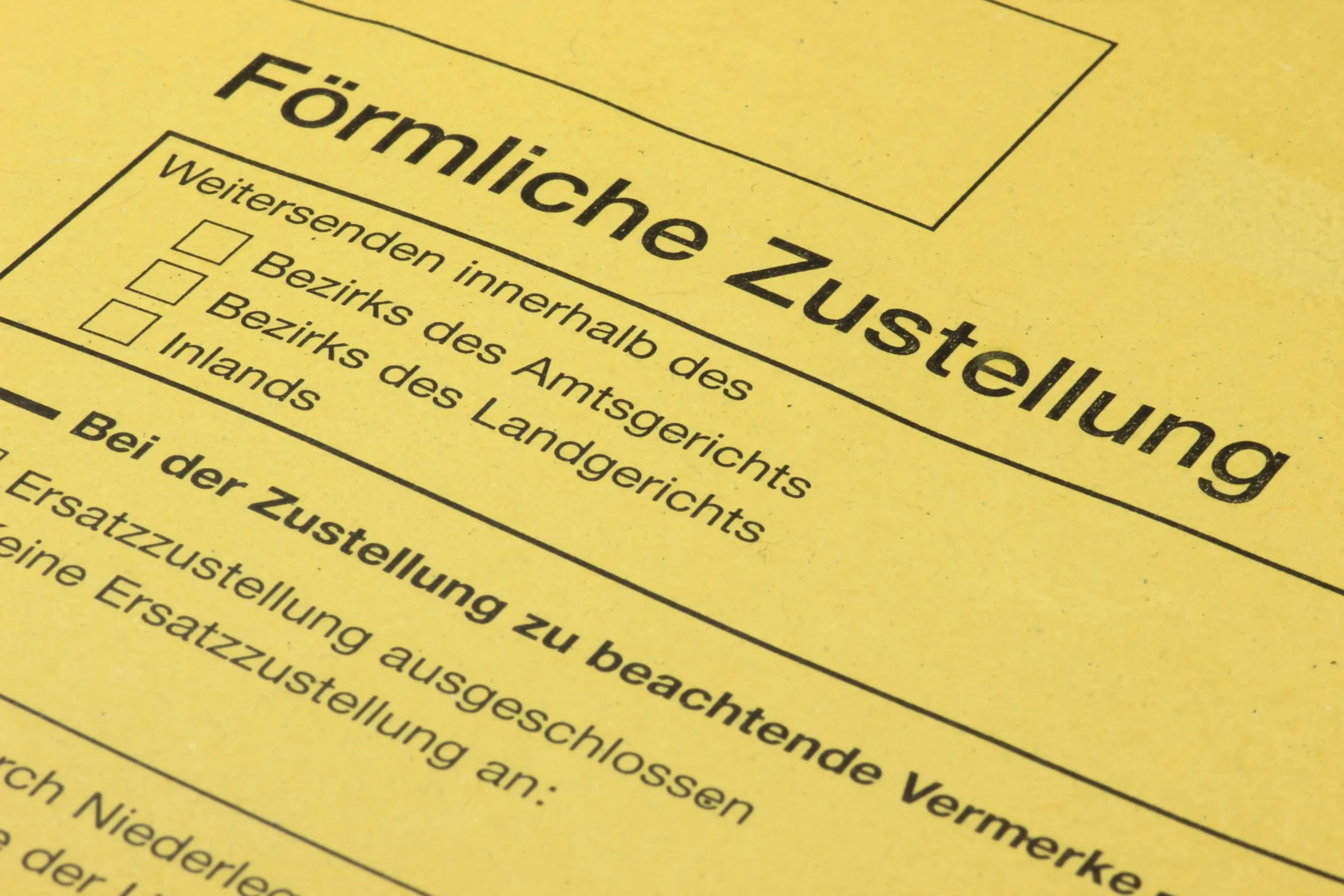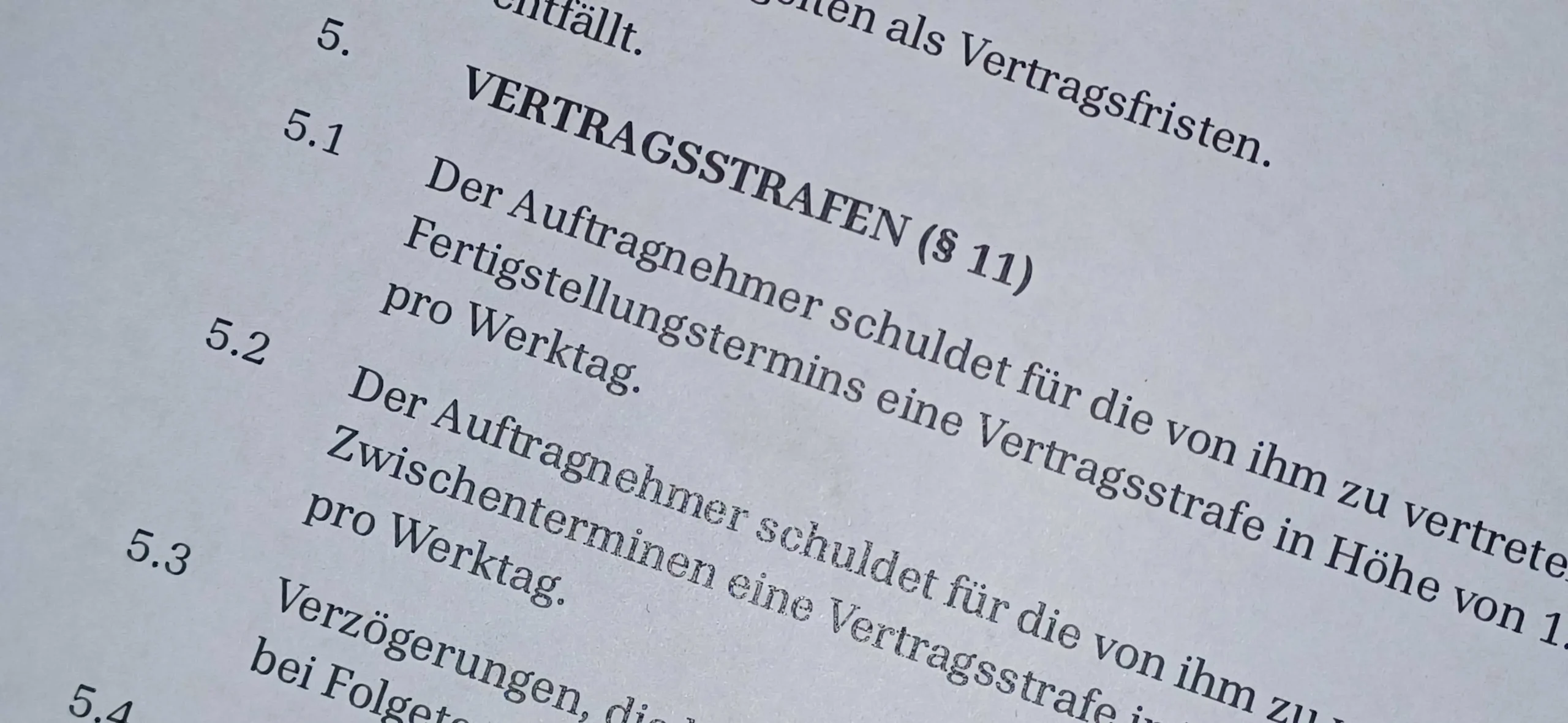Rechtsstreit im Baurecht – Wann kommt es auf ein Gutachten an?
Ein Bauvorhaben ist grundsätzlich ein äußerst komplexes und störanfälliges Unterfangen. Vertragliche Bestimmungen decken sich oft nicht unbedingt mit den realen Bedingungen. Viele Faktoren bestimmen sich gegenseitig und ein völlig reibungsloser Ablauf ist nahezu unmöglich.
Unterschiedliche Gewerke bauen aufeinander auf, das Wetter macht der Planung mitunter einen Strich durch die Rechnung, die wirtschaftliche und persönliche Lage der Baubeteiligten kann sich ändern, Termine und Fristen können teilweise nicht eingehalten werden und letztlich kann die vereinbarte Qualität der erbrachten Leistungen nicht bestimmungsgemäß erreicht werden. All diese Umstände sind nur einige Beispiele aus einer Vielzahl von Möglichkeiten, die zu einem Rechtsstreit zwischen den Beteiligten im privaten Baurecht führen kann.
In diesem Beitrag möchten wir den Fokus einmal auf ein konkretes Thema im Zusammenhang mit Mängeln am Bauvorhaben werfen: Das Baugutachten.
Das Baugutachten nährt seine Bedeutung vor allem bei der Bestimmung von Baumängeln und Schäden am Gebäude und spielt eine entscheidende Rolle bei der Rechtsprechung. Vor allem die Auftraggeber, also die Bauherren, profitieren zumeist von der Heranziehung eines Baugutachtens. Die Bauherren haben gemäß dem unterzeichneten Bauvertrag einen Anspruch auf eine vertragsgemäße Errichtung der gewünschten Immobilie in fehlerfreier Ausführung entsprechend der aktuell gültigen Richtlinien und technischen Bestimmungen, die für den Neubau von Immobilien bestehen. (VOB/B bzw. BGB – DIN-Normen, Stand von Wissenschaft und Technik, etc…)
Ein konkretes Beispiel aus unserer Beratungspraxis
Familie A beauftragt das Bauunternehmen B mit der Errichtung eines Einfamilienhauses. Das Bauunternehmen B bedient sich Subunternehmern für die unterschiedlichen Gewerke. Während der Bauphase kommt es zu Verzögerungen, da Baumängel offensichtlich werden, auf die nachfolgende Gewerke nicht aufbauen können. Die Baumängel werden von einem Subunternehmer erkannt und offen kommuniziert. Dieser verweigert aufgrund der Mängel durch Vorgewerke die Aufnahme seiner eigenen Folgetätigkeit.
Familie A stellt neben den vorhandenen Baumängeln fest, dass nun vertraglich vereinbarte Zwischenfristen nicht eingehalten werden und verweigert folglich die Zahlung von den jeweiligen Abschlägen an das Bauunternehmen B.
Das Bauunternehmen B verlangt hingegen die Zahlung der offenen Abschlagssumme, Familie A verlangt wiederum die fachgerechte Beseitigung der Baumängel unter Fristsetzung. Das Bauunternehmen B bestreitet das Vorhandensein von Baumängeln…
Hierbei wird schnell klar, dass eine komplexe Kette von Zusammenhängen und Folgen entsteht, ebenso wie unterschiedliche Schuldverhältnisse und wechselseitige Ansprüche. Diese wollen wir nun außer Acht lassen, da dieser Beitrag über die Ufer unseres Themas treten würde.
Zurück zum Kern unseres Lupenspots: Die Baumängel und das Baugutachten.
Treten Baumängel am Gewerk auf oder besteht die Vermutung, dass Baumängel bestehen, sollte der Bauherr immer direkt handeln.
Fahrplan: Wie muss man sich als Bauherr verhalten?
- Baumängel identifizieren und dokumentieren (Protokoll, Fotos)
- Hier genügt es zunächst selbst tätig zu werden und eigene Fotos anzufertigen und die jeweiligen Mängel nebst Fotos in einem Protokoll zu dokumentieren.
- Ggf. Rechtsbeistand aktivieren,
Die Heranziehung eines Rechtsbeistandes hilft, bereits von Anfang an alle nötigen Schritte rechtlich abzusichern und Versäumnisse oder Folgen von fehlerhaftem Handeln zu vermeiden.
Bereits an diesem Punkt wird das Thema privates Baugutachten zumindest durch den rechtlichen Beistand angesprochen und in der Regel empfohlen. - Ggf. vorhandene Rechtsschutzversicherung aktivieren
- Baumängel beim jeweiligen Vertragspartner anzeigen (Baumängelanzeige mit förmlicher Zustellung)
Abhängig von der Art der Mängel und in welchem Gewerk die Mängel auftreten, sollten die Mängel entsprechend bei dem jeweiligen Vertragspartner angezeigt werden. Haben Sie einen Generalunternehmer beauftragt, so ist dieser bei sämtlichen Mängeln Ihr Ansprechpartner. - Eine Handlungsaufforderung unter angemessener Fristsetzung (ebenfalls mit förmlicher Zustellung) an den Vertragspartner übersenden.
Die Handlungsaufforderung sollte immer eine angemessene Fristsetzung enthalten, da mit dieser weitergehende rechtliche Aspekte wie Verzug des Vertragspartners in Kraft gesetzt werden können und nach Ablauf der Frist ein Baugutachten aufgegeben werden kann.
In der Regel ist es empfehlenswert, die Anzeige der Baumängel mit der Handlungsaufforderung zu verknüpfen und beides in einem Schreiben an den Vertragspartner zu verbinden.
Grundsätzliches
Hinweis: Grundsätzlich ist zu beachten, dass das Vorkommen von Baumängeln nicht gleich ein Mangel der komplett erbrachten Leistung bedeutet und wohl auch nicht jeder festgestellte Mangel eines Baugutachtens bedarf.
Ein Baugutachten sollte in der Regel frühstens nach der ergebnislos verstrichenen Frist der Handlungsaufforderung in Auftrag gegeben werden. Andernfalls könnten Kosten für das Gutachten entstehen, die gar nicht nötig waren, da der Vertragspartner unkompliziert die Mängel anerkennt und entsprechend beseitigt. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen Eilbedürftigkeit absolute Priorität hat und entsprechend kurze Fristen gesetzt werden können, um schnell Gegenmaßnahmen treffen zu können.
Funktion des privaten Baugutachtens
Um das weitere Vorgehen hinsichtlich eines Baugutachtens einordnen zu können, ist wichtig zu wissen, welche Funktion ein privates Baugutachten im Verhältnis zum Vertragspartner oder zum Gericht einnimmt.
Dem privaten Gutachten kommt hauptsächlich die Funktion der Beweissicherung zu. Der Sachverständige protokolliert und dokumentiert mit dem Gutachten in angemessener Form jegliche Mängel des Bauwerks.
Dieser Sachverständige kann jedoch auch schlichtweg Nachforschungen anstellen, wenn zunächst ermittelt werden muss, ob überhaupt Mängel im eigentlichen Sinne bestehen und welche Bedeutung diese für den weiteren Verlauf haben können. Der Hauptanwendungsfall eines privaten Baugutachtens ist jedoch der, dass man um Mängel weiß und diese aufgrund der äußeren Umstände schnell beseitigt und fachgerecht protokolliert und dokumentiert werden müssen.
Eine etwaige spätere gerichtliche Auseinandersetzung wird hinsichtlich der Beweislage durch ein privates Baugutachten vereinfacht.
Das Gutachten kann aber auch als Grundlage für das weitere Vorgehen gegenüber dem Bauträger genutzt werden, beispielsweise um gemeinsam Lösungen zur Mängelbeseitigung zu finden und zu bestimmen, in welchem Maße Kompromisse hinsichtlich der Bezahlung und der Mängelbeseitigung angemessen sind.
Im Streitfalle und vor Gericht wird das private Gutachten als sogenannter substantiierter Parteivortrag behandelt. Das bedeutet, dass das Gutachten eine Grundlage für die Überzeugungsbildung des Gerichts sein kann. Jedoch kommt dem Privatgutachten nicht die gleiche Beweisfunktion zu, wie einem gerichtlich eingeholten Sachverständigengutachten.
Zurück zu unserem Praxis- Beispiel (s.o.)
Familie A wäre nach ergebnislos verstrichener Frist nunmehr zu raten, ein privates Baugutachten in Auftrag zu geben. Dieses würde protokollieren und dokumentieren, dass die vom Subunternehmer erkannten Mängel tatsächlich bestehen und Aussagen darüber treffen, welche Bedeutung den Mängeln für den weiteren Bauverlauf zukommen.
Des Weiteren besteht so die Möglichkeit, dass im Falle einer eilbedürftigen Mangelbeseitigung, beispielsweise aufgrund von Wassereintritt, eine Dokumentation des Ist-Zustandes gewährleistet ist und trotzdem unter Umständen ein anderes Drittunternehmen mit der Mangelbeseitigung beauftragt werden kann. Außerdem kann die Dokumentation und Auswertung durch das Gutachten dazu führen, dass Bauunternehmer B die Mängel nunmehr doch anerkennt und diese beseitigt.
Macht es Sinn, als Bauherr ein eigenes Gutachten in Auftrag zu geben?
Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, ob ein eigenmächtig beauftragtes Gutachten als Bauherr überhaupt Vorteile birgt und auch, ob dieses später dann durch das Gericht verwertet werden kann.
Unsere klare Antwort: Ein privates Baugutachten in Auftrag zu geben, birgt deutlich mehr Vor- als Nachteile.
Die Beweissicherungsfunktion des Gutachtens ist der größte Vorteil des privaten Gutachtens. Wie bereits erläutert, ermöglicht das Baugutachten es den Bauherren, den Ist-Zustand zu protokollieren und danach ggf. trotzdem weiterzubauen und Mängel beseitigen zu können. Des Weiteren wertet ein Baugutachten im Regelfall die Mängel auch aus und gibt eine Einschätzung dazu, mit welchem zeitlichen Aufwand und mit welchen Kosten für die Mängelbeseitigung zu rechnen ist. Im Übrigen ermöglicht das Baugutachten eine Grundlage für weitere Verhandlungen oder kann als Beweismittel im Gerichtsverfahren eingebracht werden.
Der einzige Nachteil eines privaten Baugutachten ist jedoch, dass die Kosten hierfür von den Bauherren vorerst selbst getragen werden müssen und dass keine Garantie für ein -für die Bauherren- vorteilhaft ausfallendes Gutachten besteht.
Wie bereits kurz angesprochen, handelt es sich bei einem privaten Baugutachten um einen sogenannten substantiierten Parteivortrag. In einem zivilrechtlichen Gerichtsverfahren ist immer entscheidend, welche Vorträge und Beweise von den jeweiligen Parteien vorgebracht werden. Diese nennt man Parteivortrag. Ein substantiierter Parteivortrag ist ein solcher, der bereits Beweise enthält und mit mehr Inhalt gefüllt ist als eine reine Behauptung.
Beispiel:
Parteivortrag: Das Gewerk hat Mängel.
Substantiierter Parteivortrag: Die Mängel des Gewerks wurden auch im Baugutachten des Sachverständigen festgestellt.
Ein Privatgutachten wird vom Gericht jedoch erstmal nur dem Parteivortrag an sich, also dem „Lager“ der jeweiligen Partei zugeordnet. Die gegnerische Partei kann Einwendungen gegen das Gutachten erheben und beispielsweise beantragen, dass ein gerichtliches Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben wird.
Bei einem gerichtlich aufgegeben Sachverständigengutachten wird davon ausgegangen, dass dieses objektiv und unabhängig ist. Dies kann bei einem Privatgutachten nicht direkt angenommen werden, da der private Gutachter ja auch von einer der Parteien beauftragt wurde und somit immer ein gewisses Näheverhältnis besteht. Des Weiteren können die Fragen des Gerichts unter Umständen objektiver und konkreter sein.
Das Gericht darf sich also grundsätzlich nicht einfach so einem Privatgutachten anschließen, vor allem nicht, wenn der Gegner Einwendungen gegen dieses erhoben hat. Insofern das Gericht eigene Sachkunde besitzt und auch darlegt, dass es aufgrund der eigenen Sachkunde in der Lage ist, die streitigen Fragen abschließend zu beurteilen, kann das Privatgutachten jedoch ausreichen.
Als Gutachten an sich kann das Privatgutachten im gerichtlichen Verfahren nur verwertet werden, wenn die gegnerische Partei der Verwertung zustimmt. Sollte dies geschehen, kann der Sachverständige als sachverständiger Zeuge vor Gericht gehört werden und er kann noch Angaben über seine Feststellung machen.
Da dies jedoch für die gegnerische Partei in aller Regel ungünstig sein kann, wird die Zustimmung hier eher selten erteilt.
Vor- und Nachteile des Privatgutachtens
Vorteile – kurz & knapp:
• Beweissicherungsfunktion
• Einschätzung zum zeitlichen und finanziellen Aufwand zur Mängelbeseitigung
• Grundlage für die Kommunikation mit dem Vertragspartner
• Einführung als Beweismittel in einem Gerichtsverfahren
Nachteile – kurz & knapp:
• Kostentragung vorerst beim Auftraggeber des Sachverständigen
• Andere Beweiskraft als ein gerichtliches Sachverständigengutachten
Wann genau ist ein Gutachten erforderlich?
Vor allem im Hinblick auf die Kostentragung stellt sich für Bauherren die Frage, ab wann es erforderlich ist, schnell zu handeln und ein privates Gutachten erstellen zu lassen. Schnelligkeit ist vor allem geboten, wenn der Verdacht besteht, dass so Verschleierungen oder Vertuschungspfusch durch das Bauunternehmen vermieden werden kann oder die Mängel sich so gestalten, dass sehr schnell gehandelt werden muss.
Ein Gutachten ist grundsätzlich immer dann notwendig, wenn der Zustand ordentlich protokolliert werden soll und so entsprechend Beweise gesichert werden können. Je größer der etwaige Mangel und der daraus resultierende Schaden, desto eher sollte ein Privatgutachten in Auftrag gegeben werden.
Das Prinzip der Beweissicherung wurde nunmehr bereits mehrmals erwähnt. Eine Beweissicherung ist eine Maßnahme, welche den konkreten Zustand eines Bauwerks feststellt. Eine Beweissicherung bei Baumängeln dient der Feststellung der Mängel, bevor die Mängel behoben werden. Dies dient entweder der Durchsetzung des Anspruchs auf Mängelbeseitigung gegenüber dem Vertragspartner oder der Durchsetzung etwaiger späterer Schadensersatzansprüche.
Der Bezug zu unserem Beispiel aus der Praxis (s.o.)
Für Familie A wäre ein Gutachten nunmehr erforderlich, um die Mängel zu protokollieren und die Mängelbeseitigung vorantreiben zu können. Vor allem da Bauunternehmen B das Vorhandensein von Mängeln bestreitet, könnte auch die Gefahr bestehen, dass das Bauunternehmen B ohne Gegenmaßnahmen die Mängel verschleiern könnte.
Welche Art von Gutachten wird benötigt?
Baugutachten können grundsätzlich in drei Kategorien eingeteilt werden. Welche Art von Gutachten benötigt wird, hängt letztendlich davon ab, weshalb man das Gutachten in Auftrag gibt.
Bisher ging es hauptsächlich um die Erstellung eines privaten Gutachtens und dessen Stellung in einem etwaigen Gerichtsverfahren, jedoch gibt es neben dem Privatgutachten noch das gerichtliche Sachverständigengutachten und das sogenannte Beweissicherungsverfahren, welches ebenfalls ein gerichtliches Sachverständigengutachten zum Inhalt hat.
1. Das Privatgutachten
Das Privatgutachten wir von einer Partei selbst in Auftrag gegeben. Die Partei sucht sich den Sachverständigen in der Regel selbst aus. Das Privatgutachten ist die effizienteste Art der Beweissicherung bei Mängeln.
Das Privatgutachten wird zumeist bereits außergerichtlich und vor einem Gerichtsprozess in Auftrag gegeben, es kann aber auch erst während eines Gerichtsverfahrens in Auftrag gegeben werden.
Grundsätzlich dient ein Privatgutachten dazu, entweder außergerichtlich mit dem Vertragspartner eine Lösung zur Mängelbeseitigung zu finden oder im Falle eines Gerichtsverfahrens das eigene Parteivorbringen ausreichend zu substantiieren.
2. Das gerichtliche Gutachten
Ein gerichtliches Sachverständigengutachten wird vom Gericht in Auftrag gegeben, wenn bereits ein streitiges Gerichtsverfahren läuft und zur Beantwortung von konkreten Fragen die Expertise eines Sachverständigen benötigt wird. Das Gericht sucht den Sachverständigen selbst aus und gibt in der Regel auch die vom Sachverständigen zu beantwortenden Fragen vor.
Das gerichtliche Sachverständigengutachten ist gemäß §§ 404 ff. ZPO als eigeständiges Beweismittel vor Gericht zugelassen.
Aufgrund dessen, dass der Sachverständige für das gerichtliche Gutachten durch das Gericht selbst ausgewählt wurde, hat dieser den Vorteil, dass er als objektiv wahrgenommen wird. Jedoch wird erfahrungsgemäß, vor allem beim Hausbau nicht gewartet, bis ein gerichtlicher Sachverständiger die Mängel begutachten kann, bevor weitergebaut oder die Mängel beseitigt werden, sodass ein gerichtlicher Sachverständiger meistens nicht alle Mängel vor Ort begutachten kann. In diesen Fällen kann es sein, dass sich der gerichtliche Sachverständige des Privatgutachtens bedient, um einen Überblick zu erhalten.
Aufgrund der Erkenntnisse des Sachverständigen, welcher in der Regel auch in der mündlichen Verhandlung gehört wird, kann das Gericht dann gem. § 286 ZPO eine freie Beweiswürdigung treffen.
3. Das selbstständige Beweisverfahren
Eine weitere Möglichkeit stellt das sogenannte selbstständige Beweisverfahren gemäß § 485 ZPO dar.
Im Rahmen des selbstständigen Beweisverfahrens kann eine Partei bei Gericht beantragen, dass eine Beweissicherung durch einen gerichtlichen Sachverständigen durchgeführt wird, ohne dass bereits über einen etwaigen Anspruch an sich gestritten oder entschieden wird.
Die Fragen, welche durch einen Sachverständigen beantwortet werden sollen, müssen dabei vom Antragsteller im Rahmen des Antrags eingereicht werden. Die Fragen dürfen nicht „ausforschend“ sein und die Antwort nicht vorwegnehmen. Sachverstände sollen und dürfen grundsätzlich keine Rechtsfragen beantworten.
Das selbstständige Beweisverfahren ist nur die gerichtliche Beweisaufnahme, ohne materielle Prüfung des Anspruchs. Für diese Prüfung müsste ein weiteres Verfahren, das Hauptsacheverfahren, angestrebt werden.
Vorteilhaft am selbstständigen Beweisverfahren ist, dass die gegnerische Partei als Antragsgegner direkt involviert ist und die Ergebnisse des Verfahrens in einem etwaigen späteren Hauptsacheverfahren als Sachverständigenbeweis verwendet werden können.
Der Bezug zu unserem Beispiel aus der Praxis (s.o.)
Für Familie A gibt es nunmehr verschiedene Varianten, wie sie weiter gegen Bauunternehmen B vorgehen könnte.
Variante 1: Einholung eines Privatgutachtens und erneute außergerichtliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung.
Familie A könnte ein Privatgutachten einholen und sich dieses zu eigen machen und nochmals an Bauunternehmen B herantreten und die Mängel samt dem Gutachten erneut anzeigen und entsprechende Mangelbeseitigung fordern.
Variante 2: Einholung eines Privatgutachtens und Klage auf Mängelbeseitigung oder Schadensersatz.
Familie A könnte ein Privatgutachten einholen und Klage vor dem zuständigen Gericht auf Mängelbeseitigung gegen das Bauunternehmen B einreichen. Das Privatgutachten wird als Substantiierung ihres Vortrages vor Gericht genutzt. Das Gericht wird wahrscheinlich ein eigenes Sachverständigengutachten in Auftrag geben.
Variante 3: Klage auf Mängelbeseitigung oder Schadensersatz.
Familie A könnte direkt auf Mängelbeseitigung vor dem zuständigen Gericht klagen. Jedoch fehlt es ohne Privatgutachten an glaubhaften Beweismitteln. Eine Bestandsaufnahme zum Zeitpunkt des Auftretens der Mängel liegt nicht vor. Das Gericht wird ein gerichtliches Sachverständigengutachten in Auftrag geben, dieses kann jedoch nur den Ist-Zustand zum Zeitpunkt der Klageerhebung bewerten, zu welchem ggf. Mängel bereits behoben wurden.
Variante 4: Antrag für ein selbstständiges Beweisverfahren.
Familie A könnte beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Durchführung eines selbstständigen Beweisverfahrens stellen, um die Mängel direkt von einem gerichtlich bestellten Sachverständigen protokollieren und dokumentieren zu lassen.
Für welche Variante sich Bauherren entscheiden, hängt zumeist von verschiedenen Faktoren wie Eilbedürftigkeit und der Art der Mängel ab. Besprechen Sie die Varianten vor einer Entscheidung sorgfältig mit Ihrem Rechtsbeistand.
Wen sollte man mit der Erstellung eines seriösen Baugutachtens beauftragen?
Grundsätzlich kann nur von einem unabhängigen Baugutachter oder Sachverständigen ein realistisches und objektives Gutachten erwartet werden. Ein eigenes Gutachten durch das Bauunternehmen selbst oder durch einen Kooperationspartner ergibt wenig Sinn, da das Ergebnis sicherlich zugunsten des Bauunternehmens ausfallen würde.
Die gleichen Einwendungen können selbstverständlich auch den Bauherren gegenüber gebracht werden, wenn diese einen Sachverständigen beauftragen. In manchen Fällen kann es hilfreich sein, mit der gegnerischen Partei in Kontakt zu treten. Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit, dass gemeinsam ein Sachverständiger ausgewählt wird.
Fragen Sie bei Ihrem Rechtsbeistand nach Empfehlungen für Sachverständige!
Wer beauftragt die Erstellung eines Gutachtens?
Grundsätzlich sollte die Partei das Gutachten in Auftrag geben, die es auch benötigt. Das wird in den allermeisten Fällen die Partei der Bauherren sein. Einen Bauverantwortlichen mit dieser Aufgabe zu betrauen, ergibt wenig Sinn, da diese, wie bereits ausgeführt, wohl an einem anderen Ergebnis Interesse haben als die Bauherren und eine entsprechende Auswahl treffen werden.
Sie sind Bauherr? Im Regelfall wird Ihr Anwalt die Beauftragung nicht für Sie übernehmen. Sie sind näher an „Ihrer“ Baustelle und sind gerade im Hinblick auf die Vereinbarung von Terminen für die Besichtigung flexibler. Sollten Sie eine Übernahme dieser Tätigkeiten von Ihrem Rechtsbeistand wünschen, so müssen Sie dies individuell vereinbaren.
In der Regel beauftragen also Sie selbst als Bauherr den Sachverständigen und schließen mit diesem einen eigenen Vertrag über das Gutachten.
Was kostet ein privates Gutachten?
Eine pauschale Antwort mit einem genauen Betrag, auf die Frage, was ein privates Baugutachten kostet, gibt es nicht.
Grundsätzlich werden die Kosten eines privaten Baugutachtens von den Sachverständigen auf Stundenbasis abgerechnet, das Stundenhonorar variiert je nach Sachverständigem. Darüber hinaus kommt es dann auf weitere Faktoren, wie die Art der Mängel und den Aufwand für das Gutachten an.
Für gerichtliche Sachverständige ist zu beachten, dass diese nach Standardverordnungen vergütet werden.
Wer muss das Gutachten bezahlen?
Das private Baugutachten ist in rechtlicher Hinsicht ebenfalls dem sogenannten Werkvertragsrecht unterstellt. In der Regel wird vom Gutachter das Werk „Gutachten“ erwartet. Das bedeutet, dass sich Fragen hinsichtlich der Vergütung entweder nach der vertraglichen Grundlage zwischen Gutachter und Auftraggeber beantworten oder nach der gesetzlichen Grundlage des § 632 Abs. 2 BGB, nach welcher für die geschuldete Leistung eine übliche Vergütung zu entrichten ist.
Sollte der Auftraggeber, also der Bauherr, Schadensersatzansprüche gegen den Bauträger oder Handwerker haben, so können die Sachverständigenkosten für das Privatgutachten ebenfalls als Schadensersatz geltend gemacht werden. Die Beauftragung des Sachverständigen muss jedoch erforderlich gewesen sein. Erforderlichkeit wird in der Regel angenommen, wenn die Mängel nicht nur ganz untergeordnete Bedeutung haben.
Die Kosten des Privatgutachtens können auch erstattungsfähig sein, wenn das Privatgutachten zur Vorbereitung eines gerichtlichen Prozesses notwendig war, darüber muss das Gericht jedoch ebenfalls eine Entscheidung treffen oder sich entsprechend äußern. Notwendig ist das Privatgutachten bereits meistens schon dann, wenn keine eigene Expertise gegeben ist.
Der Bezug zu unserem Beispiel aus der Praxis (s.o.)
Familie A würde die Kosten eines Privatgutachtens im Falle einer Klage ersetzt bekommen, da das Privatgutachten zur Vorbereitung des Prozesses notwendig war und die Familie selbst keine eigene Expertise hatte.
Das Einbehalten der Abschlagszahlungen ist gängiges Vorgehen beim Auftreten von Mängel bei einer Bauleistung, dies sollte jedoch nach Möglichkeit vorher mit Ihrem Rechtsbeistand besprochen werden.
Fazit und guter Rat zuletzt
Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass private Baugutachten in einer Vielzahl von Fällen Sinn ergeben. Sie protokollieren und dokumentieren das Bauwerk samt seinen Mängeln im jeweiligen Ist-Zustand und substantiieren das Parteivorbringen im Falle einer Klage.
Wir, als Fachkanzlei Streich und Wittke für Bau- und Immobilienrecht, beraten Sie gerne zu den Themen Gutachten und Baumängel. Zwar spielt die Zeit eine entscheidende Rolle, dennoch sollten voreilige Schritte und unnötige Kosten vermieden werden. Wir klären Sie umfassend über bestehende Möglichkeiten auf und zeigen Ihnen gangbare Wege, damit Sie schnellstmöglich an Ihr Ziel gelangen und bestmöglich abgesichert sind.
Nehmen Sie bei Interesse oder Fragen am besten noch heute Kontakt zu uns auf – wir sind gerne für Sie da. Für eine optimale Vorbereitung nutzen Sie gerne unser kostenloses Kontaktformular. Hier können Sie Ihr Anliegen kurz schilden, Ihre Kontaktdaten hinterlassen und uns bereits Terminwünsche für ein Erstgespräch nennen. So können wir uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen, um gemeinsam Ihr Anliegen zu besprechen.
Weiterführende Links zum Thema
Baumängel – Was sind diese, wie werden sie rechtlich eingeordnet und was sollten Bauherren generell wissen?
Baumängel durch Planungsfehler in der Bauvorbereitung
Baumängel durch Fehler in der Rohbauphase
Baumängel durch Fehler beim Innenausbau
Baumängel durch Fehler bei der Fertigstellung
Der Werkvertrag – Baumängel & Abnahme
Die Schadensersatzklage im privaten Baurecht
Zu guter Letzt…
An dieser Stelle möchten wir uns bei unserer Co-Autorin Anna-Sophie Zdunek für das konstruktive Mitwirken an diesem Beitrag bedanken. Sie unterstützt uns als rechtwissenschaftliche Mitarbeiterin.
(Bildnachweis: AdobeStock_431407834)